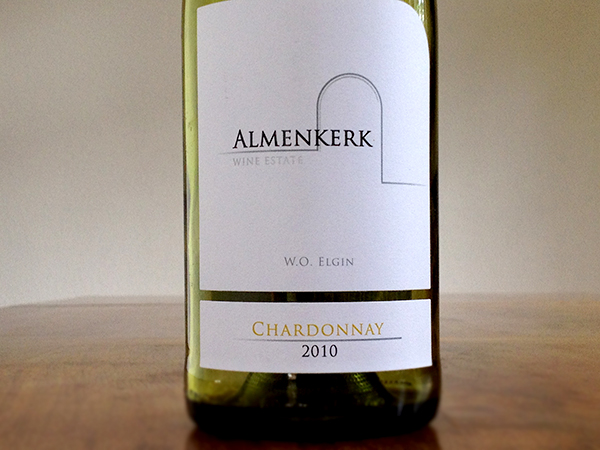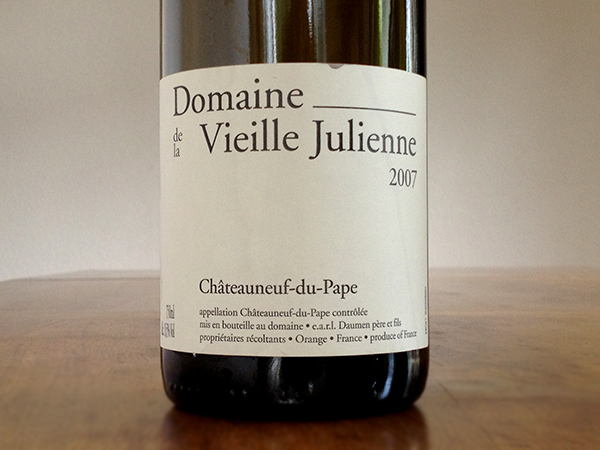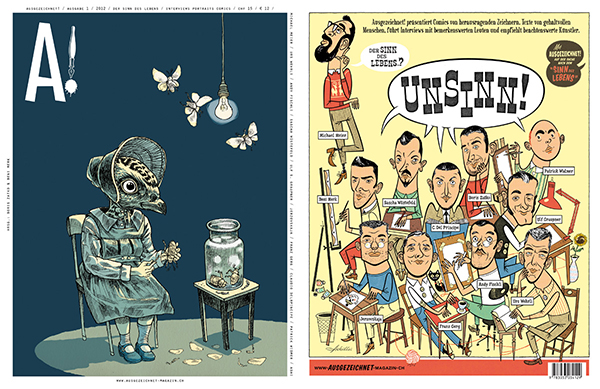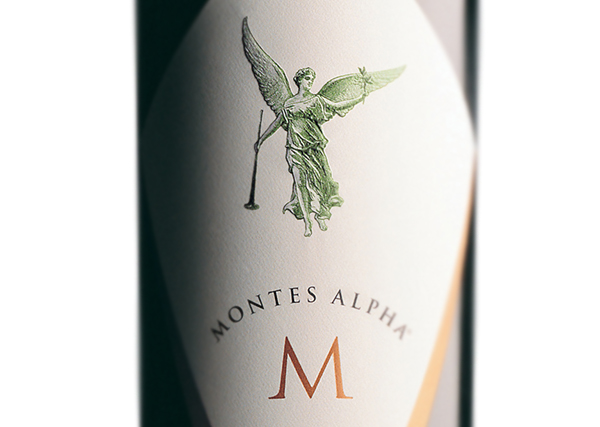Pizza mit Schnauz
Lahmacun ist manchmal die bessere Pizza.
Vor über zwanzig Jahren habe ich mich in diesen knusprigsten und dünnsten aller mir bekannten belegten Fladen verliebt.
Das war in Alanya. In einer Imbissbude von erschreckender Bescheidenheit. Mit mehr Fliegen als Gäste an den drei Tischen. Am Bestelltresen gab es nichts zu sehen als einen Backofen und Teiglinge die unter einem Leintuch Mittagsschlaf hielten.
Wir deuteten auf einen der schnauzbärtigen Männer mit durchgehenden Augenbrauen, der in etwas biss, das er zwischen seinen Händen hielt. Ich sagte nur: „Iki tane, lütfen“. Der beflaumte Milchbubi hebte nur kurz sein Kinn und machte sich ans Werk.
Im Nu hatte er zwei Teiglinge zu hauchdünnen Fladen ausgewellt und diese knapp mit einer Hackfleischsauce bestrichen.
Einen Augenblick später holte er die dampfende, mit dicken dunklen Blasen übersäte Lahmacun aus dem Ofen. Er streute ungefragt Pul Biber darüber, setzte einen Zitronenschnitz darauf und liess uns essen.
Einkassieren interessierte ihn vorerst nicht. Er wusste, dass wir nach der ersten Portion noch weitere bestellen würden!
Zu meinem grossen Glück gibt es in Basel schon fast so lange das Restaurant Pinar. Mein liebstes für Anatolische Spezialitäten.
Alles dort ist gut. Die Familie, die es betreibt und das was sie auf der Karte führen.
Die Lahmacun gehört selbstredend zu den besten, die man nördlich von Ankara serviert bekommt.
Eines der Geheimnisse besteht darin, den Teig nicht zu überladen. Dönerbuden, die ein gefühltes Kilo Rinderhack auf wagenradgrosse Fladen klatschen, sollten vom Amt für kulinarischen Anstand geschlossen werden.
Ich gebe zu, für die Zubereitung der Sauce liebe ich die europäisierte Version mit Kalbfleisch. Original wäre wohl Lamm, oft wird auch Rindshackfleisch verwendet. (Und original wird vermutlich noch nicht einmal eine Sauce gekocht, sondern alle Zutaten mit dem Hack gemischt und dann roh auf den Teig gegeben.)
Ich habe mir vom Metzger durchwachsene Kalbsbrust am Knochen geben lassen. Wer Freude am Schneiden mit scharfen Kochmessern hat, den wirds gehörig jucken: Das Fleisch wird minutiös von Hand klein geschnitten und nicht etwa durch den Wolf gedreht.
Der Teig ist simpel: Frischhefe (15 g auf ein Kilo Mehl), Weissmehl, Salz, Wasser. Drei Stunden zugedeckt gehen lassen.
Faustgrosse Teiglinge formen, bemehlen, zugedeckt 30 Minuten gehen lassen. Dann ultradünn auswellen und zum besteichen bereitstellen.
Sauce: Klein gewürfelte Zwiebeln und rote türkische Spitzpaprika glasig braten (herausnehmen und später zum Fleisch geben). Fleisch in derselben Pfanne Farbe nehmen lassen.
Passierte oder frische Tomaten dazugeben, mit Wasser bedecken, eine Stunde einköcheln lassen. Würzen mit Paprikapaste (Paprikapulver geht auch), Pfeffer, Salz. Zum Schluss glatte Petersilie dazugeben oder alternativ direkt über die dampfende Lahmacun streuen.
Die Lahmacun bei 250 Grad backen. Geht ganz schnell. Ein wachsames Auge und etwas Übung machen den Unterschied! Und noch was: Wer am Ofentürchen steht, muss wohl oder übel im Stehen essen. In einem normalen Haushaltsofen geht nur eine aufs Mal.
Ein paar Spritzer Zitrone und etwas Pul Biber zum Nachschärfen gehört dazu.
Afiyet olsun!
A propos Afiyet olsun – guten Appetit! heisst es auch im Istanbul Kochbuch von Gabi Kopp mit jeder Menge authentischer Rezepte.
Abstimmungswochenende
Blöde Frage: Was macht ein Foodblogger lieber – seinen Geburtstag feiern, oder für Vinum das Wochenende durchkochen und portugiesische Weine darauf abstimmen? Eben, blöde Frage.
Der Vorteil für die Leserschaft dieser Seiten: Ich verschenke schon heute einen Einblick. Ins Heft kommt das Wine & Food Pairing in der Dezemberausgabe.
Insalata di Polpo, Salat vom Oktopus, ist eine feine Sache. Im Sommer mache ich ihn gerne mit Stangensellerie, Peperoncino, Knoblauch, Olivenöl und Zitrone. Dieser hier ist sozusagen die Winterversion.
Ich schmore ihn wie für den sommerlichen Salat im eigenen Saft: Olivenöl mit Lorbeerblatt, Selleriestange, Knoblauch, und Peperoncino erhitzen. Polpo dazugeben, Deckel drauf, 1 Stunde bei kleinster Hitze weich schmoren.
Dazu kippe ich nach halber Kochzeit aber eine Schalotten-Wein-Reduktion (von 4 dl auf 1 dl). Das Resultat: Intensiver, tiefer Eigengeschmack. Ein Traum. Ich hab nicht einmal gesalzen.
Der 2007 Dolium Reserva ist intensiv, komplex und elegant. Passt mit seinen leichten Noten von roten Peperoni wunderbar.
Diese kleinen Freunde hier, Calamaretti, habe ich einfach zum Oktopus in den Topf gegeben. Aye! Gute Idee. Kann ich als Vorspeise so was von empfehlen. Sind butterzart. Die müssen nicht gefüllt, nicht gewürzt oder sonst wie aufgemotzt werden. Der Tintenfisch, der Weinjus, perfetto.
Am ersten Kochabend besucht mich ein Freund. Er war im Piemont und sagt, er hätte ein Problem: Weisser Alba-Trüffel. Den muss man jetzt essen! Kein Problem, sag ich. Trink dich durch acht portugiesische Weine und dazu verputzen wir etwas Kleines mit Trüffel.
Als Erstes gibt es ein Slow Egg nach Christian Seiler. Seidenweich und trüffelreich. Der junge, eher leichte Fagote Reserva 2010 gesellt sich mit seiner Frische gut dazu.
Als Primo gönnen wir uns Tajarin mit einer Butter-Käse-Sauce und weiterem Trüffel (dazu trinken wir uns durch die portugiesische Weinpalette. Schöne Weine).
Nebst dem leicht narkotisierenden Trüffelduft, der die Küchenluft schwängert, betört uns schon die ganze Zeit das schwere Bouquet vom Ragù, das schweigend auf dem Herd vor sich hin simmert. Seit fünf Stunden.
Wir können uns nicht zurückhalten und werfen ein paar Pappardelle ins schäumende Salzwasser. Die Fleischsauce ist so dick und intensiv, dass der Herzschlag einen Gang hochschaltet.
Als Nachspeise gönnen wir uns Parmesan. Einen alten Malandrone. Sehr alten sogar. Er hat unglaubliche 120 Monate auf dem Laib! Schaut nur die Salzkristalle, sehen sie nicht aus wie Sterne am Käsefirmament?
Am nächsten Tag brate ich behutsam eine Wildenten-Brust auf der rautenförmig eingeschnittenen Haut. Karamellnoten steigen auf. Ich lasse sie im Ofen bei 100 Grad ruhen und ziehe eine Rotwein-Port-Sauce mit frischen Preiselbeeren.
Das Ganze begleitet von einer schlichten Bramata-Polenta. Schon beim Degustieren vom 2010 Monte da Ravasqueira wusste ich, zu dieser tollen, vollreifen Fruchtnote, muss es Ente sein. Ein sehr schöner Pas de deux.
Für den 2008 Herdade da Servas (70% Syrah, 30% Touriga Nacional) wähle ich schlichte Past‘ e fagioli.
Der Wein ist charmant ausbalanciert und passt mit pfeffrigen Noten sehr gut zu den Umami-Komponenten Bohnen, Sellerie, Knoblauch, Tomate.
Den 2007 Perescuma Reserva mit komplex-würzigen Aromen, Frische und Wucht kombiniere ich mit einem scharf gebratenem und sanft zu Ende gegarten Lamm-Coquille auf Couscous und gebratenen Auberginen.
Beim Verkosten des 2008 Herdade do Portocarro war klar. Dieser gerbstoffreiche companheiro verträgt fettige, sukkulente Speisen. Ein Saucisson aus Neuchâtel bei dem das Fett nur so rausspritzt kombiniere ich mit Rippchen und Salzspeck.
Die süssen Komponenten vom Rotkraut und den glasierten Marroni bringen dann die fruchtigen Noten vom Wein sehr schön nach vorn.
Ein Sonntagsessen sondergleichen wurde das schlichte Ossobuco mit Safranrisotto alla Milanese (und seit dieser Nummer halte ich mich an das asketische Rezept).
Elegant herausgeputzt kommt auch der 2008 Herdade da comporta daher. Lang ist er, mit weichen Tanninen und feinen Holznoten.
Den nimmt man nach dem Essen auch gerne mit aufs Sofa rüber, um dem sonntäglichen Nickerchen sanfte Träume zu entlocken.
Aber vorher muss noch die Paarung Monte da Ravasqueira 2009 mit Salsiccie al Monte de Ravasqueira (statt al Barolo) getestet werden. Na ja, eine Kombo muss auf dem letzten Platz landen.
Eigentlich liebe ich dieses Gericht: Peperoncino geschärfte Salsiccie al Finocchio braten, mit einer Flasche Wein aufgiessen, Kartoffeln und Pepperoni dazugeben und warten bis alles gut wird.
Hier hat es nicht so richtig funktioniert, denn die Säure überwiegt und auch die Schärfe ist dem Wein nicht zuträglich (die Eiche ist zu dominant). Dieser fällt im Vergleich zum 2010 (der mit der Entenbrust) ohnehin deutlich ab. (Zu den Tajarin al Tartufo hingegen, hat er sich sehr gut verhalten).
Was die verpasste Geburtstagsfeier betrifft: Die Kocherei und Testerei hat mich mehr als entschädigt!
Kleiner Rahmen, grosses Kino
Am Tag an dem ich den Anruf bekam, kam richtig Freude auf.
Ich hatte soeben einen Job vom Irish Food Board, Bord Bia, erhalten. Der ehrenvolle Auftrag: Schweizer Spitzenköche für die Gründung des Chefs‘ Irish Beef Club Schweiz zusammenzubringen.
Ein paar Tage später stand ich mit Kolja Kleeberg, Thomas Kammeier und Marco Müller auf dem Rasen der privaten Residenz des Irischen Botschafters in Berlin Grunewald.
Oh, Danny Boy – Champagner und Petites Bouchées gehen erstaunlich gut zu einer Parkvilla im Bauhaus-Stil. Und Berlin, nebenbei, zeigte sich im Baströckchen. An diesem milden Mai-Abend sorgten 30 Grad für eine geschmeidige Club-Stimmung.
Ich dachte ja, bei der Gründung des Chefs‘ Irish Beef Club Germany wären bestimmt an die 100 Gäste geladen. 19 waren wir dann insgesamt. Ein gebührender Rahmen, um den Austausch unter Aficionados von Irish Beef zu zelebrieren.
Für die Gründung des Schweizer Clubs am 29. Oktober hatten sich die Iren Schnee gewünscht. Ich habe ihr Klischee belächelt und erklärt, dieses Jahr sei der Oktober extrem mild und im Moment wäre praktisch immer noch Sommer.
Aber Fairytales werden auch mal wahr und in der Nacht vor dem Gründungs-Lunch warf es generös Schnee bis ins Flachland. Was unter anderem leider einige von der Feier abschnitt. Von den zehn ausgewählten Schweizer Küchenchefs waren sieben bei der Gründung anwesend.
Umso gemütlicher dafür die Stimmung am Kachelofen und im Gourmet-Stübli bei Gastgeber Tobias Funke in seinem Obstgarten in Freienbach.
Eine richtiggehend konspirative Clubgründung bei einer Degustation von irischem Whiskey und einem fantastischen Grand Irish Menu:
Apéro: Fisherman’s Pie, Parsley Soup, Black Pudding, Egg Ice with Caviar and Bacon Foam. Dazu Champagne Delamotte, Blanc de Blanc.
Amuse: Alpen-Saibling, Cipollotti, Rote Zwiebel Sauce, Cipollottiwurzel im Tempurateig, in Holzkohle gegarte Stachis.
Tobias Funke kocht auf 16 Gault-Millau Punkten. Richtig glücklich ist er, wenn er mit seinen Kreationen bei seinen Gästen punkten kann.
Jakobsmuschel gegart, gegrillt und als Carpaccio, Gurke, Traube. Dazu 2010 Grassnitzberg, Tement, Südsteiermark.
Schöner Scherbenhaufen: Drei Variationen von der Jakobsmuschel auf zersägten Tellern zu einem perfekten Gang inszeniert.
Hat sich vermutlich noch kein Ire je so einverleibt: Modern Interpretation of Irish Stew (zarteste Lammschulter, 48h sous-vide gegart). Dazu 2008 Blaufränkisch Reserve, Krutzler Südsteiermark.
Dry Aged Hereford Côte de Boeuf. Dazu 2009 Sondraia, Poggio al Tesoro.
Kürbistörtchen mit flüssigem Bierkern, Baileys, Bolivia Chocolate. Dazu 2008 Chardonnay Beerenauslese, Tschida, Neusiedlersee.
Iren können auch Käse: Ziege, Kuhmilch, Blauschimmel.
Es gibt keine finanziellen Vorteile für die Member Chefs, dafür umso mehr ideelle. Die überzeugten Botschafter von Irischem Rindfleisch werden sich gemeinsam in Workshops über Tradition, Produktionsbedingungen und Qualität austauschen.
Nächstes Frühjahr steht eine Studienreise nach Irland auf dem Programm. Das A und O, um hinter die Geschichte von Irish Beef zu kommen.
Die Gründungsmitglieder des Chefs‘ Irish Beef Club Schweiz, von links:
- Tobias Funke, Funkes Obstgarten
- Arno Sgier, Traube
- Bruno Hurter, Waldhotel
- Richard Stöckli, Alpenblick
- Heinz Rufibach, Alpenhof
- Urs Keller, Kongresshaus
- Dominic Lambelet, Ackermannshof
- (nicht anwesend: Markus Gass, Adler, Roman Meyer, OX, Ueli Grand, Startgels).
Bilder: Flurin Bertschinger, Ex-Press AG
Reif für die Fleisch-Insel
Es ist wie mit dem halb leeren oder halb vollen Glas. Man kann Irland so oder so sehen – als immer graue oder immergrüne Insel. Je nachdem, ob der Blick nach oben oder nach unten geht.
Aber eines ist sicher – der Regen ist ein Segen. So sehr die Iren mit ihrem Regenwetter hadern, so froh sind sie im Grunde darum. Viel Regen bedeutet nämlich viel Gras. Richtig gutes, saftiges Gras.
Stellt man da Rinder und Schafe drauf, hat man schon vieles richtig gemacht, um richtig gutes Fleisch zu produzieren. Denn füttern braucht man die frei weidenden Tiere nicht. Abgesehen von den paar Winterwochen, wenn das Wetter gar zu garstig wird und man sie reinnehmen muss.
Die Angus-Boys lieben den Auftritt vor Publikum.
Ansonsten sind die Tiere dank mildem Golfstrom und gemässigtem Klima praktisch das ganze Jahr hindurch draussen. Und fressen nichts als dieses natürlich gewachsene Gras. Kost und Logis kosten den Farmer somit nahezu null.
Das ist nicht nur praktisch, das ist auch nachhaltig. Weil die Tiere nicht mit Getreide gefüttert werden, das man zuvor mit entsprechendem Energieaufwand anbauen muss. Mit anderen Worten: Dieses Vieh frisst niemandem das Essen weg. Die natürliche Weidekost führt dazu noch zu einem hoch aromatischen Fleisch.
Es ist eindrücklich. Dieses von einer Krise zur nächsten gebeutelte Land lebt zu einem grossen Teil vom Fleischexport. Rund 90% der Produktion geht ins Ausland. Und wir reden hier von einem Family-Business. 50% der Farmen sind Familienbetriebe mit durchschnittlich gerade mal 150 Tieren.
Die Gummistiefel borgen wir uns vom Farmer (der mit dem Houndstooth Cap). An die Krawatte für den Gang auf die Weide hätten wir selbst denken müssen.
Und ich? Ich darf mir das alles vor Ort anschauen. Ein Stubenhocker auf Studienreise quasi. Inmitten von Fleischprofis, vom Importeur Delicarna (den ich kommunikativ betreue) zum Grosshändler bis zum Feinkostmetzger, sind wir als Gruppe unterwegs zu Produzenten und Verarbeiter. Was bin ich für ein Glückspilz!
Das Programm ist allerdings nichts für Warmduscher. Wir landen spät abends in Dublin, kippen im Flughafenhotel ein paar Pints Kilkenny und stellen den Wecker auf Nullsechshundert. Am frühen Morgen geht es nach Waterford in den Schlacht- und Zerlegebetrieb des führenden Fleischproduzenten abp.
Übrigens, Kilkenny Bier heisst eigentlich nur für den Export Kilkenny. In Irland heisst das Bier Smithwicks. Aber sprich das mal auf Deutsch aus. Eben.
Nach einer kurzen Firmenpräsentation folgt eine peinlich genaue Prozedur mit dem Ausfüllen von Gesundheitsfragen. Gefolgt von akribischen Sicherheits- und Sauberkeitsmassnahmen, bevor man uns weiss bekittelt, behelmt und gummibestiefelt in die gekühlten Hallen schleust. Ich fühle mich wie Jesse Pinkman auf dem Weg in die Welt der wirklich echten Profis.
Der Zerlegebetrieb ist ein perfekt strukturierter Ameisenbau. Das Tempo der hoch konzentriert arbeitenden Männer, die im Kettenschurz entbeinen und zuschneiden, ist respekteinflössend.
Dann beobachte ich einen, der sein Messer abzieht. Er stellt seinen Wetzstahl senkrecht auf die Arbeitsplatte und geht so nahe heran, als wolle er es auf Beschädigungen inspizieren. Aber dann setzt er das Messer an und zieht die säbelartig gekrümmte Schneide ab. Ganz, ganz langsam. Links, rechts. Links, rechts. Andächtig. Ein Samurai? Da kommt ihm das nächste Fleischstück auf dem Band entgegen und schni-schna-schnipp! ist das Ding pariert.
Ich hätte gerne ein paar Bilder veröffentlicht. Von den Karkassen. Von dem Typen auf dem Lift mit der verblendeten Riesensäge (einer der Wichtigsten, weil er die Karkasse exakt der Länge nach teilen muss). Oder der bösen, überdimensionierten Schere, mit denen man die Rinderhälften in Vorder- und Hinterviertel teilt.
Ich halte mich aber zurück. Nicht jeder mag, wie ich, darin die rohe Ästhetik sehen, wie sie andere in, sagen wir mal, Stahlwerken sehen. Hier werden schon mal Assoziationen an blutige Operninszenierungen von Skandalregisseur Calixto Bieito geweckt. Bloss, das hier ist keine Show. Und obwohl es zu unserer Kultur gehört, will es praktisch niemand sehen.
Ein wenig ziehe ich innerlich auch über die die Menschen her, deretwegen ich die Bilder zurückhalte. Ich meine diese heuchlerischen Susies, die schon beim Anblick von Tatar oder Markbein hysterisch kreischen. Die aber zu blöd oder zu blind sind zu fragen, woher ihr eingeschweisstes Schnitzel in der Selbstbedienung kommt. So viel sei verraten: Es wächst nicht auf Bäumen.
Die Iren haben die Hausaufgaben gemacht. Und sie haben eine Mission: Sie wollen eine Fleischerzeugung mit höchstmöglichen Standards in Punkto Nachhaltigkeit und Qualität.
Rib Eye – ein Hohrücken für höchstes Entzücken – ziehe ich jedem Entrecôte vor.
Dass sie auf gutem Weg sind, bezeugen zahlreiche internationale Auszeichnungen und Prämierungen oder das Nachhaltigkeitsprogramm Origin Green vom Lebensmittelverband Bord Bia, Irish Food Board. Auch die Spitzengastronomie schwört auf Irish Beef, wie man auf der Chef Sache gesehen hat, beim Bocuse d’Or 2013 noch sehen wird, oder beim Chefs‘ Irish Beef Club, der demnächst auch in der Schweiz gegründet wird.
Eine Besonderheit hat das Fleisch von abp, die andere nicht haben. Ihr Ultra Tender Beef hängt nach einem eigens entwickelten Verfahren ab: Der Stretching-Methode. Dabei wird die Rinderhälfte nicht am Fersbein, sondern am Schlossbein aufgehängt und gestreckt. Dadurch werden die Muskelfasern gedehnt und das Fleisch wird nachweislich zarter.
Leider konnten wir diese Zartheit in den wenigen Restaurants und Pubs in denen wir essen gingen, nicht geniessen. Diese Barbaren braten das Fleisch schlicht zu Tode. Denen wünsche ich einen übel gelaunten, bös verkaterten Gordon Ramsay an den Hals!
In Camolin gab es Einblick in den erstklassigen Betrieb von Irish Country Meats. Ein Spezialist für bestes Irisches Lamm. Darunter auch Bio-Zertifiziertes.
Die meisten Farmer haben übrigens weniger als eine Stunde Fahrtweg zu ihrem Schlachtbetrieb. Und es gibt auch so manche Familie mit etwas Land, die sich einfach so nebenher Rinder oder Schafe halten.
Im ländlichen Strassenbild sind deshalb immer wieder gewöhnliche Personenwagen zu sehen, die in einem kleinen Anhänger zwei bis drei Tiere zum Schlachthof fahren.
Wenn der Nordwind um die Ohren pfeifft, wärmt man sich am besten mit einem kühlen Guinness.
Die Reise war intensiv und lehrreich. Die irischen Erzeuger machen einen extrem reifen, verantwortungsvollen Eindruck. Man kann verstehen, dass sie stolz auf ihre Erzeugnisse sind. Und wer einmal in ein perfektes Dry Aged Côte de Boeuf beisst, weiss was ich meine.
Ich stehe ja schon seit Jahren darauf. Jetzt weiss ich auch, warum.
Hätte nicht gedacht, dass ich als erwachsener Mann noch Mal ein Gesicht machen würde wie ein Junge, der soeben ein feuerrotes Feuerwehrauto zu Weihnachten geschenkt bekommen hat.
Gehet hin und backet
Die Stadt Linz trägt nicht nur pflichtbewusst Sorge zu der nach ihr benannten Torte. Nein, sie hat da auch einen äusserst gewissenhaften Verantwortlichen für die Links der Tourismus-Seite der Stadt.
Dieser Herr hat mich diese Woche freundlich darüber in Kenntnis gesetzt, dass meine Verlinkung zum original Linzer Torten Rezept nicht mehr aktuell ist. Ich möchte mich doch bitte um das Problem kümmern.
Selbstverständlich habe ich das umgehend und – habe die Ehre – noch so gerne erledigt. Hier ist der aktualisierte Beitrag über Gotti Ernas Linzer Torten Rezept inklusive neuer Verlinkung.
Wer nun Bock auf Backen hat, kann das Original in Angriff nehmen oder sich an Gotti Ernas Variante halten. Weil ich das Rezept damals, und auch in meinem Buch, nicht vollständig veröffentlicht habe, gibt es jetzt endlich ein PDF vom Rezept als Download zum nachbacken und glücklich werden.
Und wenn ihr dabei in Schwung kommt, dann könnt ihr schon mal vorproduzieren – Weihnachten kommt bald!
Hallo Herbst!
Wozu jammern über den Verlust des Sommers? Mit dem Herbst kommt doch für uns Kulinariker die Erntezeit, der wir das Summum abgewinnen können.
Mit grösster Vorfreude habe ich mich darum an das Aushecken und Zubereiten eines reichen Menus gemacht.
Auf dem Herbstteller gab es als Einstieg wunderbar pfeffrige Hirschsalami von Tichy und Wildschweinschinken. Darunter versteckt sich ein halber Steinpilz. Mal eben kurz mit Schalotten in Butter geschwenkt.
Dazu die ersten glasierten Marroni. Gedämpft, geschält und dann langsam mit Karamellzucker, Butter und Fleur de Sel überschmelzt.
Die perfekt gereiften italienischen Feigen habe ich im Ofen mit Staubzucker und Weisswein gebacken. Und schliesslich ein Apfel-Chutney aus den eigenen Sauergrauech-Äpfeln dazu gereicht.
Den Sirup mit Schalotten, Senfkörnern, Ingwer, Rohrzucker und Zimt eindicken lassen – ohne Apfelstücke drin, damit sie nicht zerfallen. Würfelchen davon lieber alleine in einer Pfanne kurz und heftig anbraten und dann unter den fertigen Sirup heben. Passt übrigens auch sehr gut zu Käse.
Dazu Riesling von Boxler. Mal mineralischer, mal harmonischer. Beide eine Wucht.
Den Butternut-Kürbis gab es als Süppchen mit Safran und selbst gemachtem Gemüsefond. Veilchen als Farbtupfer und süss-saure Crevette als Abschiedsgruss an den Sommer.
Exotischer aber sehr gesitteter Begleiter dazu ein Chardonnay aus Südafrika.
Das Herzstück im Trüffelrisotto ist ein rosa gebratenes Medaillon vom Rehrücken. Die Sauce dazu gezogen aus den ausgelösten Knochen, Mirepoix, Rotwein, Port und aromatisiert mit Nelken, Wacholder, Zimt und Thymian.
Dieser Côtes-du-Rhône ein respektvoller Begleiter, dem auch ein Steinpilzrisotto geschmeckt hätte.
Zum dritten Mal hab ich nun das Sieben-Stunden-Lamm nach Anthony Bourdain aufgetischt. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Um 6 Uhr morgens aufgestanden, nur eine Tasse Weisswein als Flüssigkeit verwendet und minuziös den Creuset mit Brotteig zugespachtelt.
Das Resultat kann sich sehen und vor allem schmecken lassen. Den eingedickten Bratenjus habe ich vor dem Servieren nochmals kurz mit Weisswein deglaciert. Die 20 Knoblauchzehen die man herausfischen konnte, waren herrlich karamellisiert und zart wie Pralinen.
Als Beilage gab es blaue St. Galler-Kartoffeln, die als Püree leider etwas von ihrem intensiven Violett einbüssen.
Dafür hat dieser Papst unseren Durst nach intensiven Purpur bestens gestillt.
Karamelliger geht fast nicht. Das ist selbst für Kalbsbäckchen harte Konkurrenz.
Die Vieille Julienne konnte bestens Paroli bieten. Komisch, ich hätte schwören können, dass wir dazwischen noch eine Bottiglia di Barolo getrunken haben. Aber die Flasche ist entweder verschwunden oder in meinem sanften Rausch abgetaucht.
Der Käsehändler vom Basler Markt streckte mir ein Stück entgegen und warnte: „Sind Sie sicher, dass sie diesen Gorgonzola piccante versuchen möchten? Der macht süchtig!“ Das muss der erste ehrliche Dealer sein, den ich getroffen habe.
Zum Dessert zwei Mal Todsünden von Maître Pâtissier Jacques, Mulhouse: Chocolat und Caramel au Fleur de Sel. Mein Gast, der am nächsten Tag nach Kalifornien geflogen ist, meinte treffend: „Wenn mein Flieger morgen abstürzt, hat es sich wenigstens gelohnt!“
Ach ja, Dessertwein war auch noch und lange, lange Gespräche und ein noch längerer Nachhall auf einen schönen Herbstauftakt.
Selam aus Kappadokien
Solche Postkarten schreibt mir mein Genussgenosse und AK-Illustartor Patrick aus seinen Ferien. Te?ekkür ederim!
Güvec ist ein kolossal schmackhaftes kappadokisches Schmorgericht. Wer es nicht kennt, dem sei es wärmstens empfohlen. Ich hab vor Jahren einmal dieses Rezept dazu gepostet – und heute beim erneuten Lesen sehr geschmunzelt:
Im Kommentar habe ich zum ersten Mal Katha, der zur Zeit angesagten Autorin von Österreich vegetarisch, die Hand geküsst. Da waren wir sogar noch per Sie!
Jetzt noch ein Tipp für alle, die am Wochenende in der Region Winterthur unterwegs sind. Am Samstag gibt es im Bistro der alten Kaserne um 17 Uhr eine Comic-Lesung aus dem Comic-Magazin Ausgezeichnet!
Das Magazin ist ohnehin ein Must-have, mit eigenartigen Geschichten und Interviews von einzigartigen Zeichnern und Autoren. Selbst eine Geschichte mit Herrn Gri von Patrick und mir ist drin.
Was mit Kochen ist? Ja, auch. Hab ein Sommerend-Slash-Herbstbeginn-Menü vor. Wenn Bilder und Rezepte was werden, werd ich berichten.
Die purpurnen Güsse
Das Weingut Montes in Chile. Wer genau hinsieht, erkennt die Feng Shui-Bauweise. Wer genau hinhorcht, kann die gregorianischen Choräle hören, mit denen die Weinfässer rund um die Uhr bespielt werden. Und wer erstmals diese Weine trinkt, dem eröffnet sich eine neue Welt.
Weinblogger – die haben vielleicht ein schönes Leben! Entkorken eine Flasche und legen los mit geniessen. Irgendwer macht Essen. Unsereins steht derweil stundenlang am Herd und zerbricht sich den Kopf, was man dazu trinken könnte.
Nur so am Rande: Einer meiner liebsten Weinblogger, Finkus Bripp, ist jetzt auch Weinhändler und ich kann es kaum erwarten, endlich seine beiden Mädels Lolita und MILF kennenzulernen!
Ich durfte mich letzthin auch einfach mal hinsetzen und geniessen. Auf Einladung von PR-Queen Dorli Muhr and the Golden Grapegirls a.k.a. Wine & Partners.
Gastgeber in Caduff’s Wine Loft war Aurelio Montes jr. Er hat seine Weine gleich selbst vorgestellt. Mir und dem Chefredaktor des Hotellerie et Gastronomie Magazins Jörg Ruppelt. Also quasi eine Privataudienz – und eine höchst angenehme und erhellende dazu.
Als Begleitung gab es irische, argentinische und US Filet-Steaks. Eines aromatischer als das andere. Für das Pairing mit den Weinen wären jedoch andere Cuts mit unterschiedlichen Fettanteilen vielleicht aufschlussreicher gewesen.
Montes war einer der ersten, der Ende der Achtziger in Chile auf die Produktion von Premium-Weinen setzte. Mit Erfolg: Die Weine werden mittlerweile in 120 Länder exportiert und erreichen Bestnoten bei Tastings.
Der Montes Purple Angel ist eines der Aushängeschilder Montes. Ein Carménère mit 8% Petit Verdot. Sein Name verdankt er dem Umstand, dass die Rebe beim Zeitpunkt der Lese keine Blätter mehr trägt und der Rebberg deshalb in einem intensiven Purpur strahlt. Er ist sehr würzig, mit pfeffrigen Noten von Tabak und ausgereiften Beeren, präsenten Tanninen und guter Länge.
Das Flaggschiff Montes Alpha M kommt im Nadelstreifen daher, elegant und eloquent. Er hilft dir abends die Krawatte zu lockern, Brian Ferry aufzulegen und erst mal anzukommen. Und mit jedem Schluck gefällt einem mehr und mehr was er zu sagen hat. Bis man beschliesst, zusammen dieses gut abgehangene Filet-Steak in die Pfanne zu hauen und mit nichts als Fleur de Sel zu geniessen.
Etwa 80 Kilometer Luftlinie weiter östlich, ennet den Anden, betreibt Montes mit Kaiken seit ein paar Jahren erfolgreich Weinbau in Argentinien.
Ein Schlitzohr ist der Kaiken Ultra. Ein heissblütiger Malbec (mit 6% Cabernet Sauvignon), der fettiges Essen und laute Parties mag. Gefällt mir gut. Etwas gespreizt beim ersten Treffen, aber dann möchtest du ihn am liebsten ins Stadion schmuggeln, um mit ihm und einer fettigen Bratwurst dein Team anzufeuern bis du heiser bist. Auch bei einem kräftig gereiften Hartkäse blitzt seine Klasse durch und du spürst, dass du ihm blind vertrauen kannst.
Sein grosser Bruder, der Kaiken Mai, ist ein reiner Malbec. Er spielt in der Liga der Top-Weine. Bringt Reife, Komplexität und einen seidenweichen Abgang genau auf den Punkt. Für den mehr als dreifachen Preis gegenüber dem Ultra aber ein Wein, für den man die richtige Gelegenheit – Heiratsantrag? – gut planen will.
Fazit: Ich habe meine stereotype Haltung abgelegt, per se keine Weine aus Übersee zu trinken. Natürlich schlägt mein Herz für europäische Weine. Aber rationell gesehen, gibt es keinen Grund, sich gutem Wein zu enthalten. Auch wenn er aus Südamerika kommt.
In der Schweiz bekommt man die Weine exklusiv über Haecky.
Bilder: Montes und Kaiken
Nordisch by Nature: Salzwiesenlamm
Fast muss ich dankbar dafür sein, dass beim Geflügelhändler auf dem Markt in Lörrach alle Vögel schon ausgeflogen waren. Denn so hatte ich Augen für die wenigen Fleischstücke beim Händler am Stand gegenüber. Der verkauft eigentlich mehr so Oliven, Pilze, Wurst und Käse.
„Seit wann verkauft ihr denn Lamm?“ frag ich. „Nicht oft, aber wenn, dann ist das ein Glückstag für Sie, so viel steht fest! Das ist Salzwiesenlamm ausm Norden.“
Ich hatte schon pre-salé Lamm von der französischen Atlantikküste und vorzügliches walisisches Lamm, das ebenfalls unglaublich zart und würzig ist, weil es die Matten an der salzigen Meerebrise abgrasen darf – und nun also das nicht minder geschätzte Salzwiesenlamm.
Ich kann nur sagen: Ein Festessen der ganz seltenen Art!
Und ich empfehle sehr: Bitte nicht überwürzen. Die ach so verbreitete Kräuterkruste, die bei Lammracks so beliebt ist, wäre hier wirklich ein Frevel.
Ich habe das Karree eine Stunde vor dem Braten aus dem Kühlschrank genommen und dann – ohne alles – in einer Gusseisenpfanne bei mässiger Hitze in geklärter Butter rundherum goldbraun gebraten.
Dann bei 12o Grad auf das Ofengitter gelegt bis es eine Kerntemperatur von 70 Grad hatte. Ofen ausschalten und vor dem Anschneiden bei offener Ofentüre 5 Minuten ruhen lassen.
Am Tisch stellt man den Gästen Fleur de Sel und Telly-Cherry-Pfeffer hin. Die meisten begnügen sich mit dem Salz! Zumal die Beilagen für viel Freude sorgen.
Vor allem die Cannellini-Bohnen: Mit einem Soffritto aus Knoblauch, Sellerie, Rosmarin und Olivenöl starten. Wenig Tomatenmark dazugeben und etwas Röstaromen annehmen lassen. Dann aufgeweichte Cannellini-Bohnen mit etwas Wasser dazugeben und langsam einkochen. Salzen, pfeffern.
Wunderbare Ergänzung dazu, konfierte Cherrytomaten: Halbieren und auf einem Blech mit Backpapier verteilen. Salzen, pfeffern und grosszügig mit Puderzucker bestreuen. Frische Kräuter nach belieben (zum Beispiel Thymian). Olivenöl darüber tröpfeln und etwa 2 Stunden bei 120 Grad Umluft konfieren, bis daraus schön klebrig-schrumpelige Bonbons werden.
Aus dem Bratensatz der Gusseiesenpfanne eine Reduktion aus Rotwein, Kalbsfond und Demiglace ziehen und mit eiskalter Butter montieren.
Einen Klacks Tapenade von schwarzen Oliven macht sich sehr gut auf dem Teller. Ebenso die sehr knusprigen, sehr salzigen neuen Bratkartoffeln.
Selten so glücklich vor einem leeren Teller gesessen.
Wann ist Werbung Werbung?
Für mich fängt Werbung bei der Partnersuche an. Wenn man versucht, sein Gegenüber zu verführen und für sich zu gewinnen. Die beste Werbung soll bekanntlich die Mundpropaganda sein. Eine gute Empfehlung unter Freunden ist Gold wert. Sowohl für Käufer wie für Bieter.
Werbung hört für mich dort auf, wo sie plump, aufdringlich und doof ist. Das ist leider der grösste Teil des Kuchens. John Hegarty formuliert es sinnigerweise so: „Good advertising is probably like making a great sauce. It just takes time.“
Und dann gibt es da neuerdings diese Foodblogs und die ewige Frage nach Unabhängikkeit, Werbefreiheit und Authentizität.
Bei meinem letzten Beitrag hat die mir bis anhin unbekannte – aber langjährige – Leserin Harriet einen Kommentar hinterlassen. Ich nutze die Gelegenheit, meine Antwort darauf zum Thema zu machen. Denn so wie Harriet, denken vielleicht auch andere Leserinnen und Leser dieses Blogs. Vielleicht beantworte ich also dieselben Fragen gleich mit.
| Lieber Claudio, ich lese deinen Blog seit einigen Jahren und das wirklich sehr, sehr gerne. Ich mag deine Schreibe, deine Art zu kochen, deinen Humor – dein Blog hat, Verzeihung, Eier. Was mir aber überhaupt nicht gefällt, ist das Maß, in dem hier das zunimmt, was man im weitesten Sinne “Produktvorstellungen” nennen könnte. Oder einfach: Werbung. Ich weiß, du würdest nie über etwas berichten, das du nicht selbst gut findest. Aber trotzdem. Ein bisschen schade ist es. |
Danke für deine Offenheit, Harriet. Schön, dass dir meine Texte schon so lange Freude bereiten.
Du hast recht, ich würde nie über Dinge schreiben, die ich nicht gut finde. Und selbst wenn ich Produkte gut finde, gerne shoppen gehe und Neues teste, ist dieser Blog keine Ablage für vorgefertigte PR-Texte oder Werbepostillen. Auch wenn das einige PR-Verantwortliche diverser Unternehmen nicht schnallen.
Ich bekomme täglich Post und E-Mails mit lächerlichen Kooperationsvorschlägen und der Bitte (oft sogar mit der Anweisung!) Werbung für Sie zu machen. Nein. Mach ich nicht. Ich habe kein Interesse daran, meiner Leserschaft warme Luft oder vorgekauten Marketingbrei zu servieren.
Aber was mache ich dann? Ich berichte über Dinge aus meinem Alltag, die mit Essen, Kochen und Geniessen zu tun haben. Darum auch die drei Kategorien im Blog: Gekocht | Gegessen | Gesehen. In meinem Alltag dreht sich aber auch vieles um Werbung und PR. Denn ich bin freischaffender Texter. Ich schreibe auch für Kunden aus den Bereichen Gastronomie, Lebensmittelproduktion und -Vertrieb.
Für mich ist also Werbung oder PR nicht a priori etwas Schlechtes. Für viele Zeitgenossen scheint aber alles, was irgendwie nach Werbung riecht, nervig und verachtungswürdig. Im Fall von plumper, aufdringlicher und doofer Werbung kann ich das sogar verstehen. Davon gibt’s ja leider reichlich.
Ich werde aber immer gerne aus meiner Sicht über etwas schreiben und meiner Leserschaft eine Story drumherum bieten. Wenn es gelingt, sogar mit Witz und Selbstironie. Erlebnisse und Genüsse teilen, mich über etwas lustig machen, Dinge kritisieren und Rezepte oder Tipps abgeben.
Wenn mich also ein Produzent, Winzer oder Händler einlädt und sich die Zeit nimmt, mir seine Produkte zu zeigen, dann interessiert mich das. Ich mache es zu meinem Ding. Und wenn mich Herkunft und Hintergründe bei Laune halten oder inspirieren, dann ist die Chance gross, dass ich darüber berichte und euch davon erzähle. Oder darüber schwärme.
Denn das ist der Grund, weshalb ich vor fünf Jahren diesen Blog gestartet habe. Ich hatte sonst niemanden, dem ich das alles hätte erzählen können!
Heute teile ich dank dem Bloggen die Leidenschaft über alles Kulinarische mit sehr viel mehr Menschen. Logisch, dass da auch neue Bekanntschaften, Partnerschaften und im weitesten Sinne Kooperationen entstehen. Nebst ganz tollen Freundschaften natürlich.
Du könntest es also auch so sehen: Wir sind befreundet und schwärmen beide gerne übers Essen. Wir treffen uns zufällig und dann erzähle ich dir: „Gestern war ich im Fall auf dem Jungfraujoch, Reto Mathis hat dort seine Delikatessen-Kollektion vorgestellt …“